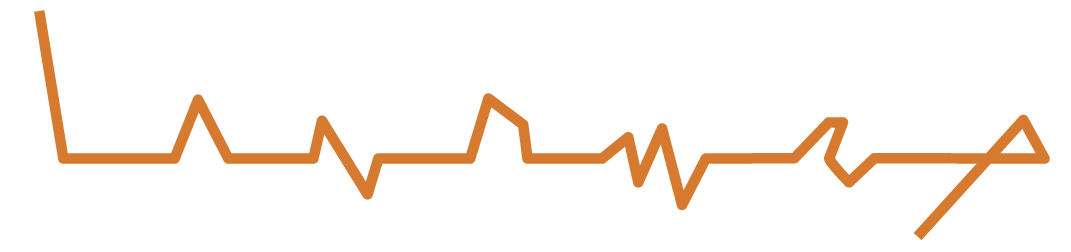Wir alle kennen vermutlich diese Situation: Kind versteckt sich hinter dem Baum, es faucht und knurrt, dann ertönt ein langgezogenes „Nä, nääää“ in Richtung der Pädagogin. Reflexhaft wenden wir uns ab, erwarten, dass die Pädagogin sich darum kümmert oder, wenn es das eigene ist, schimpfen wir; ahnend, dass es das bei der nächsten Situation wieder machen wird. „Wäre es besser, sich nicht einzumischen?“, fragen wir uns im gleichen Atemzug. Und das Kind fasst es in einem Statement zusammen: „Du hast mir gar nichts zu sagen!“ Wir denken kurz darüber nach, ob das stimmt oder was das Kind veranlasst haben könnte, so zu reagieren, bevor wir hektisch, hoffentlich ungesehen, den Platz verlassen.
Hat sich etwas verändert oder hat sich unsere Wahrnehmung verändert? Sind wir einfach älter geworden oder hatten unsere Eltern ähnliche Fragen an uns? Nachweisbar ist, dass sich das Bild vom Kind geändert hat, dass es seit ca. 100 Jahren eine starke reformpädagogische Bewegung gibt und das gesellschaftliche Umbrüche, wie z.B. Ende 1945 oder 1989 immer auch zu Umbrüchen in der Erziehung führten. Aus der Ablehnung einer Pädagogik in der die Kinder in gestärkten Lätzchen zusammen am Tisch saßen und den Tischspruch sprachen, der Ablehnung einer auf Dogmen angelegten Gesellschaft, ist unter dem Stichwort Reformpädagogik eine Ablehnung von allgemeinen Anforderungen an das Kind geworden. Montessori und viele ihrer Zeitgenossen waren aber letztlich den gestärkten Schürzen und Tischgebeten näher als viele glauben. Aus der Emanzipation von tradierten Vorstellungen ist ein großes Missverständnis gewachsen. Der Wunsch nach einer Kindheit in Freiheit wurde gleichgesetzt mit einem notwendigen Rückzug der Erwachsenen. Aus „Hilf mir, es selbst zu tun“ ist entweder ein „Gut ist, was du selbst tust“ oder gar ein„Wenn du mich in Ruhe lässt, kannst du es selbst tun“ geworden. „Hilf mir“ bedeutet jedoch das Vorbereiten der Umgebung, das Ganz – und – gar – anwesend – sein , das Zeigen, das Begleiten, das Formulieren von Erwartungen. Es bedeutet allerdings auch nicht: „Hilf mir, dass ich es nicht tun muss“
Hier wird ein Teil der Problematik deutlich. Wir können nicht an den Stellen, wo es für uns bequem ist, Montessori zitieren: „ Das Kind weiß selbst, was das Beste für es ist. Lasst uns selbstverständlich darüber wachen“ und das Konzept an den Stellen, wo es all unsere Kompetenzen herausfordert als veraltete Pädagogik ablehnen: „Das Kind formt von sich aus den zukünftigen Menschen, indem es seine Umwelt absorbiert. Eine Anerkennung dieses großen Werkes, das das Kind vollbringt, bedeutet jedoch nicht eine Herabsetzung der elterlichen Autorität; im Gegenteil, sind diese einmal davon überzeugt, nicht Baumeister, sondern Helfer des Aufbaues zu sein, werden sie umso besser ihre Pflicht erfüllen und das Kind mit größerem Weitblick unterstützen. Aber nur, wenn diese Hilfe in angemessener Form erteilt wird, kann das Kind einen guten Aufbau vollbringen. Auf diese Weise stützt sich die Autorität der Eltern nicht mehr auf ihre Wünsche an sich, sondern auf die Hilfe, die sie ihren Kindern zuteil werden lassen. Darin gründet die wahre große Autorität und Würde der Eltern“ M. Montessori glaubte nicht, dass das Kind von allein wächst, sie hat den Erwachsenen in ihren Schriften nie aus seiner Verantwortung entlassen, ihn als Teil der vorbereiteten Umgebung definiert und sie behauptete, dass das Kind an seiner Umgebung wächst: „Nur die normalisierten, von der Umgebung unterstützten Kinder offenbaren in ihrer sukzessiven Entwicklung die wunderbaren Fähigkeiten, die wir beschreiben: Die spontane Disziplin, die ständige freudige Arbeit, die sozialen Gefühle der Hilfe und des Verständnisses für die anderen.“
Für uns als Eltern ist das aber alles sehr abstrakt und das Wort Autorität hat ohnehin einen Beigeschmack. Wir wissen nur, dass uns der Gedanke der Eigenverantwortung des Kindes, das Aufwachsen ohne wie auch immer geartete Zwänge (viele von uns sind deshalb aufs Land gezogen), der Gedanke von schadstofffreier und emanzipatorischer Begleitung gefällt. Wir wollen es so, wie wir es selbst erlebt haben oder wir wollen möglicherweise das gerade nicht.
Es hat sich viel verändert in den letzten 70 Jahren. Während Frauen ebenfalls zum Einkommen beitragen, haben Männer Betreuungsaufgaben übernommen. Die anwesende Mehrgenerationenfamilie, mit ihren unterschiedlichen Wertvorstellungen gibt es kaum noch in der Lebensrealität der Kinder. Um so sicherer und komfortabler wir als Gesellschaft lebten, um so selbstverständlicher erfolgte der Rückzug ins Private. Um so mehr Zeit blieb für den Einzelnen, Identitätsfindung zu betreiben.
Es ist ja durchaus trendy, sich mit 40 noch mal komplett von seinen Eltern abzuwenden, radikale Nabelschau unter dem Stichwort der radikalen Therapie. Diese Identitätssuche bis ins hohe Alter unterscheidet uns grundlegend von anderen nichtwestlichen Kulturkreisen und den Preis zahlen unsere Kinder.
Viele Eltern sind zwar da, aber aus unterschiedlichsten Gründen abwesend. Andere Eltern bedienen ihr Kind, um es zu belohnen, zu verwöhnen, um den Alltag effektiver zu gestalten, aus schlechtem Gewissen oder der Angst, nicht geliebt zu werden. Egal wie, ob wir zu sehr oder zu wenig anwesend sind in der Lebenswelt des Kindes, wir erziehen es – und wir erziehen es immer in Auseinandersetzung mit unserer eigenen biographischen Erfahrung. Kinder spiegeln, was sie sehen, was sie erleben, auch das, was sie nicht verstehen. Und so stellt das Verhalten der Kinder in unserem Haus Fragen an uns als Pädagogen und Eltern.
Das, was auf dem letzten pädagogischem Elternabend irgendwann unter dem Wortgerüst „freche Kinder“ zusammengefasst wurde, drehte sich um die Frage, wie es kommt, dass einige Kinder ihre Gefühle gar nicht steuern können, also eine mangelnde Impulskontrolle haben, es ging um Konventionen und die Frage wie wir als Eltern oder Pädagogen damit umgehen können, vor allem dann, wenn es nicht unser eigenes Kind ist. Unsere Pädagogik konsequent zu Ende gedacht, kann doch nur heißen, dass wir uns authentisch an die Kinder wenden dürfen, das wir sie nicht belehren, sondern mit ihnen im Gespräch sind, uns nicht abwenden, um die beobachtete Situation mit anderen Erwachsenen auszuwerten. Ein Kind lernt Impulskontrolle nur, wenn wir reagieren, und zwar so normal wie möglich. Es ist ja irre, dass in Häusern wie den unsrigen zeitweilig eine normale Erwachsenen-Reaktion abhanden gekommen zu sein scheint aus Angst, es falsch zu machen.
Zusätzlich tauchte die Frage auf, welche Erwartungen an Kinder im Kindergarten gestellt werden dürfen, warum Kinder „arbeiten“ müssen und ob Kinder, die nicht mit den Materialien gearbeitet haben, in die Schule könnten. Nein, können sie nicht! Sie sind sicher trotzdem irgendwie schulreif und hoffentlich auch glücklich, aber nicht schulbereit für unser Schulkonzept. Dabei geht gar es nicht um die Arbeit mit Montessorimaterialien, sondern um das Interesse und die Motivation am sinnvollen Tun. Das Erreichen der Standards für die Schulfähigkeit, nachlesbar auf jeder mittelmäßigen Website, spielt in einem Konzept, das auf Eigenständigkeit und Selbstverantwortung setzt, eben eine größere Rolle. Dabei sind besonders die emotional- sozialen Voraussetzungen relevant. Es macht in der Freiarbeit einen Unterschied, ob ein Kind im Vorschulalter Vermeidungsverhalten oder Anstrengungsbereitschaft zeigt. Kinder können viel über Konditionierung lernen, aber leider nicht an unserer Schule, denn dafür ist sie nicht konzipiert.
Kinder nehmen auf, was wir ihnen mittels unserer Authentizität und Persönlichkeit anbieten und wenn wir mit Freude und eigener Anstrengungsbereitschaft arbeiten, werden sie es auch. Wenn wir im Widerstand sind, wir als Eltern oder wir als Pädagogen, werden sie es auch sein. Wenn wir uns abwenden, werden sie sich auch abwenden oder uns so lange herausfordern, bis wir sie sehen und unseren jeweiligen Rollerwartungen gerecht werden. Das ist anstrengend, vor allem für die Kinder.
Bei allen Fragen, die zum Elternabend vielleicht offen geblieben sind, so wurde doch eines deutlich: Wir können das Dorf sein! Wir sind wenige, aber wir sind, wenn wir es wollen, eine Gemeinschaft und zumindest das ist doch ein großer Trost!