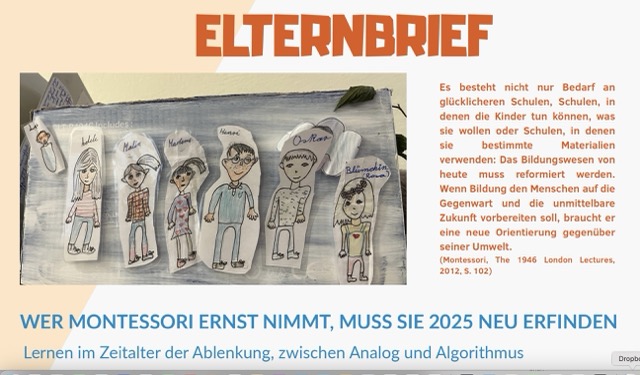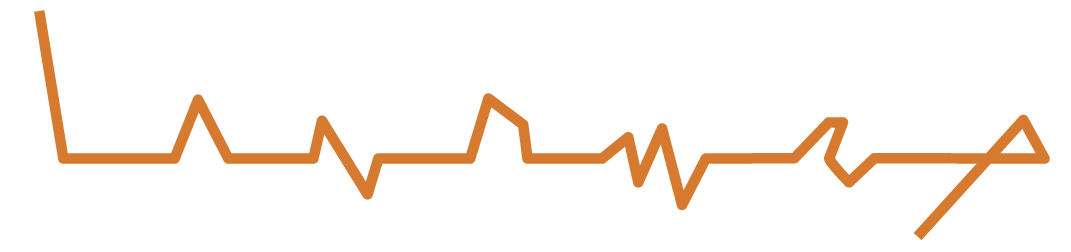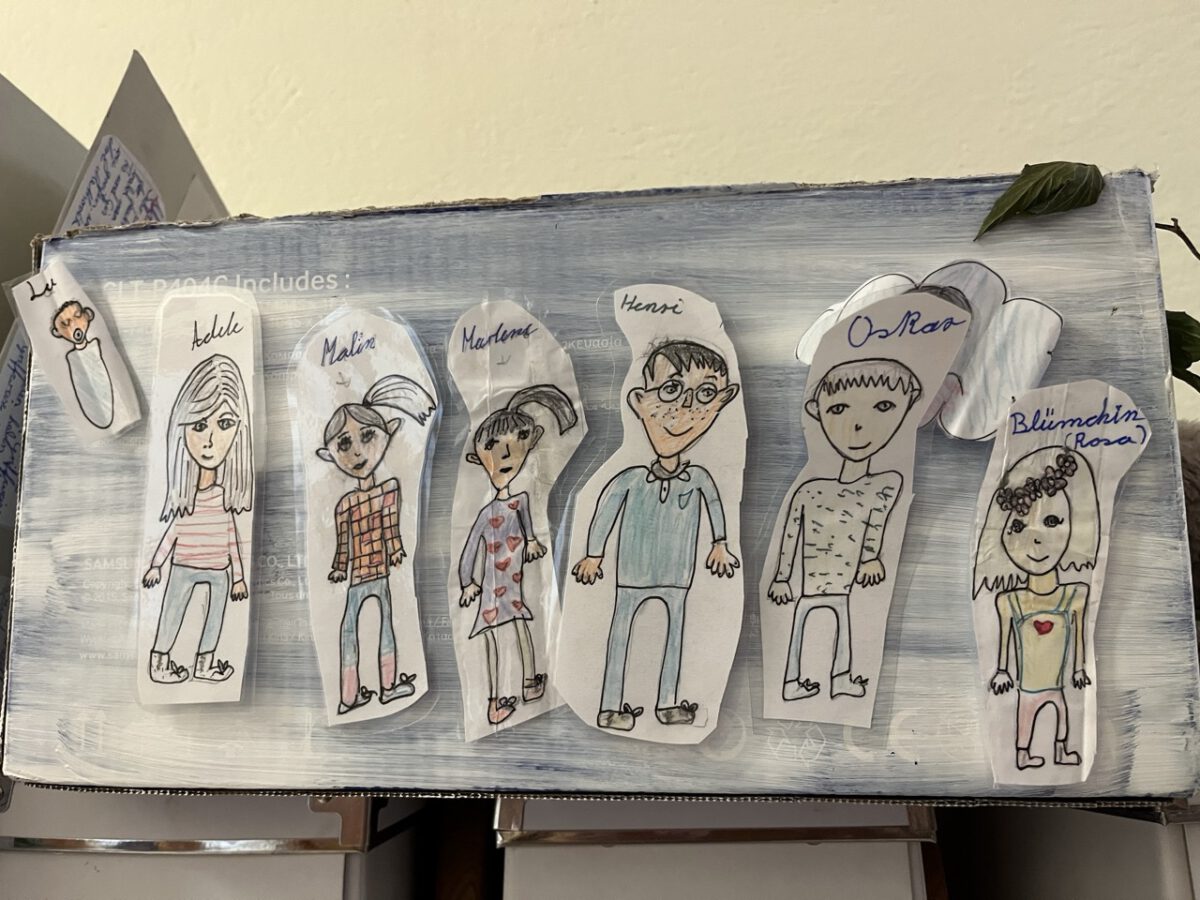Im letzten Elternbrief ging es um die Frage, wie Kinder heute mit digitalen Medien aufwachsen und lernen, auch wie wir Erwachsene oft ringen, das in unserer Begleitung richtig einzuordnen (vgl. „Kinder wissen, was sie tun“). Dieser Brief knüpft daran an, geht aber einen Schritt weiter: Wie hat sich das Lernen der Kinder verändert? Wie lernen sie inmitten permanenter Reize und Unterbrechungen und was heißt das für die Montessori-Pädagogik?
In einer Welt, die ständig neu würfelt, wirkt Schule manchmal wie Schwarz-Weiß-Fernsehen. Vielleicht war der altbekannte Satz „Wir bereiten die Kinder auf eine Zukunft vor, die wir nicht kennen“ nie wahrer als heute. Eine ganze Generation ist seit dem Anfang des neuen Jahrtausends durch die Schulen gegangen und trotzdem stehen Bildungspolitik und Gesellschaft noch immer vor denselben Fragen wie damals. Was müssen Kinder heute lernen, um im 21. Jahrhundert bestehen zu können? Während sich die Welt mit der Erfindung des Smartphones in ein digitales Dauerfeuer verwandelt hat, verharrt Schule im Testbild-Modus.
Nehmen wir ein Beispiel aus dem Schulalltag. Noch immer fließt viel Energie in Rechtschreibung und Handschrift, obwohl längst absehbar ist, dass künftig kein Kind mehr darauf angewiesen sein wird, fehlerfrei mit der Hand zu schreiben. Maschinen übernehmen das, jetzt schon. Natürlich bleibt Schreibenlernen wichtig, aber vermutlich spüren Kinder die Schieflage. Pisa 2022 (OECD 2023: PISA 2022 Results. Volume I: The State of Learning and Equity in Education) zeigt, dass Deutschland die niedrigsten Werte seit Beginn der Messungen in Mathe, Lesen und Naturwissenschaften hat. Der Absturz entspricht grob einem Lehrjahr. Das ist keine Petitesse, das ist Substanz. Und auch beim Blick auf die ersten Lernjahre zeigt sich, dass rund ein Viertel der Viertklässler den Mindeststandard im Lesen verfehlt. Der nationale IQB-Bildungstrend bestätigt diese Entwicklung (IQB-Bildungstrend 2022: Stanat, P. et al. / IQB-Bildungstrend Primarstufe 2021). Möglicherweise verweigern Kinder nicht das Lernen, sondern das Festhalten an der Simulation von gestern. Und ehrlich gesagt, es gibt viele wohlklingende Begriffe wie „zeitgemäßes Lernen“, aber die Praxis hält mit der Rhetorik kaum Schritt.
Können Kinder nichts mehr lernen? Man könnte es anders formulieren. Kinder können sehr gut lernen, aber offensichtlich nicht das, was die Schule misst. Sie navigieren durch Informationsfluten, sie erkennen Muster, sie haben neue Kommunikationsformen.
Und damit sind wir beim digitalen Elefanten im Raum. Die OECD hat auf Basis der Pisa-Daten von 2022 im Jahr 2024 sehr konkret ausgewertet, wie stark digitale Geräte im Unterricht ablenken (OECD 2024: Students, Digital Devices and Learning – PISA 2022 Zusatzbericht). Etwa 30 % der Schüler:innen geben an, dass digitale Geräte im Unterricht ablenken. Auch wenn diese Selbstauskünfte keinen Kausalzusammenhang belegen und wir hier über die Sekundarstufe reden, wird sichtbar, wie stark die Diskussion über Sinn und Grenzen digitaler Medien in Bewegung geraten ist. So hat Schweden den Kurs für die Primarstufe wieder angepasst, mehr Bücher, weniger Bildschirme, in der Vorschule sogar grundsätzlich analog.Nicht, weil Technik an sich gefährlich wäre, sondern weil frühes Lesen und Schreiben Hand und Kopf zusammenführt (Schwedische Regierung 2023: Entscheidung für mehr Bücher, weniger Bildschirme in der Vorschule).
In der Schule gibt es grundsätzlich die Möglichkeit, Gerätezeiten zu begrenzen. Am Nachmittag kann es allerdings sein, dass Kinder das Gerät gar nicht mehr weglegen, auch für das Üben nicht. Wer so unterwegs ist, lernt eigentlich im Dauerfeuer. Konzentration wird zum Zufallsprodukt statt zum verlässlichen Zustand und genau hier kippt die Waage. Üben heißt dann nicht mehr Vertiefung, sondern ständiges Anlaufen und Wiederverlieren.
Dazu kommt, dass laut der Pisa Studie 2022 (s.o.) für Deutschland belegt ist, dass die Elternbeteiligung vielerorts zurückgegangen ist. In Ländern, in denen die Eltern zwischen 2018 und 2022 stärker drangeblieben sind, hatten stabilere oder sogar bessere Ergebnisse, besonders bei benachteiligten Kindern. Auch diese Problematik kann sich mit zunehmender Digitalisierung verstärken.
Zugleich bleibt offen, ob Reformpädagog:innen selbst ausreichend reflektieren, wie sich Schule im digitalen Zeitalter verändern muss. „Kopf, Hand und Herz“ sind Grundpfeiler der Montessori-Pädagogik, doch gerade dieser Dreiklang lässt Debatten über Digitalität häufig paradox erscheinen. Wenn die Hand als Werkzeug des Denkens gilt, scheint das Tablet fehl am Platz. Neue Formen der Lernbegleitung stellen das pädagogische Selbstverständnis vieler Einrichtungen auf die Probe. Maria Montessori hat ihre Pädagogik jedoch nie als konservatives „Zurück-zur-Natur-Programm“ entworfen, sondern als radikale Antwort auf die Umwälzungen ihrer Zeit, Industrialisierung und soziale Not. Viele Analysen vergleichen die Digitalisierung heute mit einer neuen industriellen Revolution, ein Umbruch von ähnlicher Wucht. Wenn Montessori wie ein Kulturerbe behandelt wird, das man nur polieren, aber nicht anpassen darf oder wenn neue Lernformen vorschnell als Bedrohung gesehen werden, dann verliert die Pädagogik ihre eigentliche Kraft. Ein Vierteljahrhundert nach Beginn des neuen Jahrtausends wird sich entscheiden, ob Montessori noch so radikal gedacht werden kann, wie sie es zu Beginn des letzten war. Die entscheidende Frage könnte sein, ob an Grundprinzipien überhaupt gerüttelt werden darf. Der Kern der Montessori-Pädagogik liegt in Eigenmotivation und Konzentration, doch wie lässt sich das im 21. Jahrhundert leben, wenn die Lebenswelt der Kinder sie permanent herausfordert? Die Polarisation der Aufmerksamkeit zeigt sich zwar auch heute, ist aber fragiler geworden. Sie braucht Lernräume mit Struktur, klaren Rhythmen und Formaten, die Kinder ansprechen. Vielleicht braucht es heute auch in Montessorischulen mehr gemeinsame Ausrichtung auf tragende Ziele, stabile Prozesse und echtes Dranbleiben. Das lässt sich mit Eigenständigkeit sehr wohl vereinbaren. Ignorant wird es dort, wo so getan wird, als gäbe es diese Veränderungen nicht. Maria Montessori hat nie gefordert, die Augen vor der Gegenwart zu verschließen. Im Gegenteil: „Wir müssen Anpassung als eine Grundlage akzeptieren, auf der wir ein Bildungskonzept aufbauen können.“ (Montessori, The 1946 London Lectures, 2012, 96). Anpassung heißt aber nicht Nachlaufen, sondern Hinschauen: Was bewegt Kinder heute wirklich, was bestimmt ihre Wahrnehmung, ihre Aufmerksamkeit, ihr Lernen? Wer 2025 so tut, als gäbe es keine Smartphones, KI und kein TikTok, handelt nicht im Geiste Montessoris, sondern gegen ihn. Montessori darf nicht ins Museum gestellt werden, andererseits darf sie natürlich auch nicht im schnellen App-Gewand banalisiert werden. Die eigentliche Aufgabe ist es, Montessoris Prinzipien auf die Lebenswirklichkeit unserer Kinder zu übertragen. Heute bedeutet das, Lernräume so zu gestalten, dass Konzentration geschützt wird, Eigenmotivation eine Chance hat und digitale Werkzeuge bewusst eingebettet sind, nicht als Ablenkung, sondern gezielt für Recherche, Simulation und Kooperation. Immer begleitet, nie im Alleingang.
Diese Fähigkeiten entstehen nicht automatisch, sondern entwickeln sich nur dort, wo Schule und Elternhaus gemeinsam Bedingungen schaffen, auch für einen bewussten Umgang mit digitalen Reizen. Kinder, die zuhause unbegrenzt in Gerätewelten abtauchen, verlieren genau jene Konzentrationsfähigkeit, die sie in der Schule brauchen. Um es an dieser Stelle klar zu sagen, wer es wichtig findet, dass ein Kind schon im Grundschulalter oder gar im Kindergarten selbstverständlich mit digitalen Geräten aufwächst, sollte im verantwortungsvollen und Umgang mit der schulischen Entwicklung und damit mit der Zukunft seines Kindes keine Montessori-Schule wählen. Denn unser Gegenangebot, auch unser modernisiertes, wird dem nicht gewachsen sein.
Vielleicht liegt gerade darin die größte Chance für Montessori-Schulen heute: Sie können die Orte sein, an denen Kinder lernen, wie man in einer Welt voller Ablenkungen bei sich bleibt, kreativ wird und auch digitale Technik nutzt, um die Welt ein Stück besser zu machen. Nicht zuletzt, weil es im Montessori-Selbstverständnis verankert ist, Fakten zu hinterfragen und zu prüfen. Montessori kann dort aufblühen, wo alle Beteiligten Verantwortung übernehmen. Praktiker:innen dürfen Traditionen nicht museal einfrieren und Verbände wie Montessori Deutschland, die Deutsche Montessori-Gesellschaft e.V. oder die Deutsche Montessori-Vereinigung e.V. müssen die Pädagogik schützen, indem sie diese im Austausch mit der Praxis mutig weiterentwickeln. Möglicherweise auch in einem neu zu definierenden Qualitätsrahmen, der Orientierung bietet und zugleich Spielräume für Innovation lässt.
Am Ende bleibt zu hoffen, dass auch die Politik ihrer Verantwortung nachkommt und für digitale Plattformen endlich verbindliche Regeln schafft, die Kinder und Jugendliche wirksam schützen.
Maria Montessori selbst hätte kein Problem gehabt, darüber zu diskutieren. Sie hätte gefragt: Wie verändert eine neue Technologie die Entwicklung des Kindes? Und sie hätte uns gedrängt, mutige Antworten zu finden. Die eigentliche Frage lautet also nicht, ob Montessori Antworten geben kann- das konnte sie nur für ihre Zeit – sondern ob wir als Pädagog:innen, Eltern und Gesellschaft den Mut und die Kraft haben, sie radikal weiterzudenken.